Seitenstruktur
-
Nachrichten
- Monat auswählen
- März 2020
- Februar 2020
- März 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- September 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- September 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- Oktober 2014
- August 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- November 2009
- April 2000
- Monat auswählen
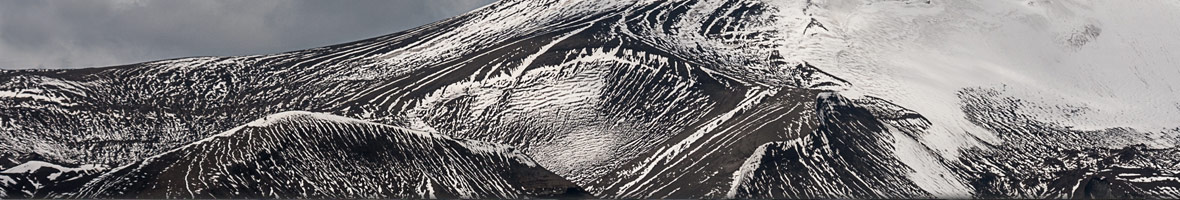
| Port Lockroy |
Home →
Jahres-Archiv: 2019 −
Das Rätsel der grünen Eisberge ist gelöst
Grüne Eisberge, auch Jade-Eisberg genannt, sind selten, aber es gibt sie. So selten sind sie, dass ihre Existenz mitunter als Seemansgarn abgetan wird. Es gibt sie aber tatsächlich, ich habe selbst mehrfach welche gesehen. Leider ist das lange her, fotografisch gesehen noch in meiner eher steinzeitlichen Phase, so dass ich keine Fotos habe, auf denen die grüne Farbe gut zur Geltung kommt.

Grüner Eisberg (Jade-Eisberg) in der Bransfield Strait, März 2003. Fotografiert mit steinzeitlicher Fototechnik als Diapositiv und später gescannt, daher ist von den schönen Farben des Originals leider wenig übrig.
Aber wenn man das seltene Glück hat, einen solchen Eisberg zu erspähen, dann ist die grüne Farbe tatsächlich sehr auffällig. Es ist nicht nur eine grünliche Variante des weithin bekannten Blautons, den viele Eisberge haben, eventuell durch einen etwas anderen Lichteinfall bedingt. Es handelt sich tatsächlich um einen völlig anderen Farbton.
Viel wurde darüber gerätselt, was die Ursache für die grüne Farbe sein könnte. Die gängigste Theorie war, dass es sich dabei um Meerwasser handele, das an die Unterseits eines Eisschelfs angefroren sein könnte. Also kein terrestrisches, glazigenes (von Gletschern stammendes) Eis, sondern gefrorenes Meerwasser. Für die Farbe sollte der im Einzelfall hohe Gehalt dieses Wassers an organischer Substanz verantwortlich sein: eingefrorenes Phytoplankton, das dem Eis die spezielle, grüne Farbe mit auf den Weg gibt.
Nun haben die Wissenschaftler Stephen G. Warren, Collin S. Roesler, Richard E. Brandt und Mark Curran eine neue Theorie aufgestellt und ihre Ergebnisse in einem Artikel im Journal of Geophysical Research: Oceans veröffentlicht. Demnach ist tatsächlich marines Eis, also gefrorenes Meerwasser, für die spezielle Farbe verantwortlich.
Damit dieses auf der Unterseite eines Eisschelfs, also in einer Tiefe von mehreren hundert Metern, am vom Land stammenden, aufschwimmenden Gletschereis, das den Eisschelf bildet, festfrieren kann, müssen bestimmte Bedingungen gegeben sein. Das Meerwasser muss unterkühlt sein. In einer Tiefe von beispielsweise 2400 Metern friert das salzhaltige Meerwasser erst bei -3,7°C. In dieser Tiefe hat etwa der Amery Ice Shelf in der Ostantarktis seine Grounding Line, wo er also auf dem Meeresboden aufliegt.

Grüner Eisberg (Jade-Eisberg) bei den Südorkney Inseln, Januar 2009. Hier ist hat das marine Eis sich in Spalten an der Basis des Eisschelfs gebildet, wodurch das grüne Eis in das blauweiß erscheinende, terrestrische Gletschereis eingearbeitet erscheint.
Der Unterschied zur älteren Theorie ist der, dass allerdings nicht ein hoher Gehalt organischer Substanz für die spezielle Farbe verantwortlich ist, sondern Eisen. Messungen an einem Bohrkern aus dem Amery-Eisschelf ergaben für das marine Eis an der Basis des Eisschelfs keine auffällig hohen Konzentrationen organischer Substanz. Dafür war der Eisengehalt höher als erwartet.
Das Eisen ist chemisch gebunden als Teil des Tonminerals Goethit, das, wie die Autoren vermuten, primär für die auffällige Färbung verantwortlich ist. Als Quelle für das Goethit wird vom Gletscher an der Basis erodiertes Gestein vermutet.
Durch seine optischen Eigenschaften neigt fein zerriebenes Goethit zu einer gelblichen Färbung, die im Zusammenspiel mit dem dichten, blauen marinen Eis an der Schelfeisbasis durch Überlagerung der Wirkung der verschiedenen farbrelevanten Substanzen zu einer im Ergebnis grünen Färbung führt.
Komplexe Sache! So schlussfolgern auch die Autoren der Studie, dass noch weitere Studien erforderlich sind: zur genauen Zusammensetzung organischer und anorganischer Beimischungen von marinem Eis und zu den optischen Eigenschaften dieser Substanzen. Letztlich würden sich solche Erkenntnisse dazu verwenden lassen, um durch Fernerkundung der Wellenlängen des Lichts, das von Eisbergen reflektiert wird, an Daten über deren chemische Zusammensetzung zu kommen.
Das wiederum wäre ökologisch durchaus relevant: der Transport großer Mengen von Eisen, chemisch in Mineralen gebunden, mit Eisbergen in Meeresgebiete im Südozean fernab der Küste, ist für die Düngung und somit das Algenwachstum durchaus bedeutend. So gewinnen die „Jade-Eisberge“ über ihre schöne, seltene Farbe hinaus für das Ökosystem des Südozeans überraschend an Bedeutung.
Das Volumen des marinen Eises ist wahrscheinlich deutlich größer, als die Seltenheit der grünen Eisberge nahelegt. Nur kleinere Eisberge, die sich drehen können und dadurch ihr Unterstes nach oben kehren, können die grüne Farbe überhaupt zeigen. Größere Eisberge können solches Eis in großen Mengen transportieren, es bleibt aber unsichtbar unter Wasser. Und natürlich muss das Licht stimmen, und dann muss man in der Nähe sein … bei weitem nicht jeder Eisschelf produziert die Jade-Eisberge in größeren Mengen, und der Amery-Eisschelf ist so abgelegen, dass dort kaum Menschen hinkommen, von den Forschern der Stationen Mawson und Davis (beide Australien) abgesehen.
Südgeorgiens Albatrosse leiden weiter unter Fischerei
Wer das Privileg hat, Südgeorgien mit eigenen Augen gesehen zu haben, weiß, dass die Insel ein Tierparadies ist. Robben, Pinguine und fliegende Seevögel gibt es dort zu hunderttausenden, teilweise in gewaltigen Kolonien.
Und es hat gute Nachrichten gegeben zur Entwicklung der Tier- und Umwelt Südgeorgiens. Zunächst wurden bis 2014 die ab 1911 von norwegischen Walfängern eingeführten Rentiere ausgerottet. Die Rentiere waren dort mit bis zu 85 Exemplaren pro Quadratkilometer unterwegs im Gegensatz etwa zu 5/km2 auf Spitzbergen. Massive Schäden an der ökologisch sehr wichtigen Grasvegetation war die Folge. Die Schäden wurden deutlich, wenn man die von Rentieren besiedelten Teile Südgeorgiens mit anderen, rentierfreien Gegenden auf der Insel verglich. Die Ausrottungsaktion, die teilweise durch Einherdung und Schlachten und teilweise durch Abschuss im Gelände erfolgte, wurde dringlich, weil der Rückzug der Gletscher es den Rentieren sonst absehbar ermöglicht hätte, weitere Teile Südgeorgiens zu besiedeln. Seit 2014 kann sich die Vegetation und damit auch die Vogelwelt auch dort erholen, wo früher die Rentierherden durch das Tussock-Gras zogen.

Ein Anblick der Vergangenheit: Rentiere auf Südgeorgien (St. Andrews Bay, 2009).
Ein noch viel größeres und ökologisch bedeutsameres Projekt war die Ausrottung der Ratten. Diese waren ebenfalls mit den Walfängern nach Südgeorgien gekommen und haben sich im 20. Jahrhundert in weiten Teilen der Insel ausgebreitet. Unter den bodenbrütenden Vögeln – und das sind praktisch alle Vögel, die dort brüten – haben die Ratten einen immensen Schaden angerichtet, indem sie Nester geplündert haben. Sowohl Eier als auch Küken fielen ihnen zum Opfer; selbst vor dem Nachwuchs von Albatrossen schreckten sie nicht zurück.
In einem mehrjährigen Kraftakt hat der South Georgia Heritage Trust Südgeorgien von Ratten befreit. Die Evaluierung ist noch nicht abgeschlossen, läuft aber bereits seit Jahren und bislang deutet alles darauf hin, dass das Projekt erfolgreich war. Das bedeutet einen gewaltigen Schritt nach vorn für Südgeorgiens Vogelwelt. Fast ausgerottete Arten wie der Südgeorgien-Riesenpiper, die jahrzehntelang nur in kleinen Populationen auf vorgelagerten, rattenfreien Inseln überlebt hatten, haben bereits wieder weite Teile des südgeorgischen „Festlands“ besiedelt.
Die Erholung der Wal- und Robbenbestände nach der intensiven Bejagung der letzten Jahrhunderte ist eine weitere gute Nachricht. Seebären („Pelzrobben“) tummeln sich heute wieder zu tausenden an den Stränden Südgeorgiens. Die Wale werden je nach Art noch Jahrhunderte brauchen, bis ihre Bestände wieder vorindustrielles Niveau erreichen, aber die Entwicklung ist immerhin positiv und für manche Arten, etwa für Buckelwale, sehr erfreulich.
Trotz all dieser Erfolge ist bei weitem nicht alles im grünen Bereich. Seit vielen Jahren sorgt der Beifang von Seevögeln in der Fischerei für einen Niedergang vieler Seevogelarten, darunter ikonische Arten wie der Wanderalbatros und dessen nahe Verwandte. Regional hat es auch hier deutliche Verbesserungen gegeben: So wurde der unbeabsichtigte Beifang von Vögeln in den Gewässern um Südgeorgien durch gute Verwaltung fast vollständig reduziert. Nur noch selten gehen einzelne Exemplare um Südgeorgien an den Langleinen an die Haken und ertrinken; für die Arterhaltung ist das kaum relevant.
Problematisch ist aber die weniger streng regulierte und praktisch nicht überwachte, oft illegale Fischerei auf hoher See, die keinem nationalen Recht untersteht. Das ist wohl die Hauptursache dafür, dass mehrere Albatrosarten auf Südgeorgien trotz strengem Schutz weiterhin kräftig zurückgehen, wie jüngere Zählungen belegen. Der Wanderalbatros ist eine der bekanntesten Charakterarten für Südgeorgien, aber auch für Graukopfalbatrosse und Schwarzbrauenalbatrosse gibt es dort Bestände von globaler Bedeutung. Aber alle diese Arten – und wahrscheinlich auch andere – erleiden weiterhin empfindliche Verluste. Dabei sind sie auf der IUCN-Liste der bedrohten Arten alle bereits mit verschiedenen Stufen der Gefährdung gelistet.

Wanderalbatros auf dem Nest auf Bird Island bei Südgeorgien.
Die Zahl der Wanderalbatrosse ist von 2003/04 bis 2014/15 um 18 % zurückgegangen, in absoluten Zahlen gesprochen sind von 1553 zu Beginn dieser Periode registrierten Brutpaaren am Ende nur 1278 übrig gewesen. Die Entwicklung der Schwarzbrauenalbatrosse ist mit einem Rückgang von 19 % sehr ähnlich. Für die Graukopfalbatrosse steht es noch deutlich dramatischer, hier liegt der Verlust gar bei drastischen 43 %.
Dabei setzte der Rückgang der Populationen schon viel früher ein, auf jeden Fall seit den 1970 Jahren, als die Forschung begann, die Bestände zu überwachen. Die heutigen Vorkommen der Albatrosse sind also nur noch ein Schatten der Kolonien, die es früher einmal gab, als Südgeorgien mitsamt dem umliegenden Südozean tatsächlich noch unberührte Wildnis war. Poncet und ihre Co-Autoren gehen davon aus, dass trotz der regional erfolgreichen Regulierung nach wie vor Beifang in der Fischerei die Hauptbedrohung für die Albatrosse Südgeorgiens ist. Albatrosse legen auf ihren Wanderungen tausende von Meilen zurück, ihre Streifzüge können sie im Laufe ihres Lebens vielfach rund um die Antarktis führen. Regionale Schutzmaßnahmen werden daher kaum wirklich erfolgreich sein können.
News-Auflistung generiert am 02. Mai 2025 um 02:07:41 Uhr (GMT+1)























